Massenbilanz 2018 als PDF
MB Bericht HSG 2018_af

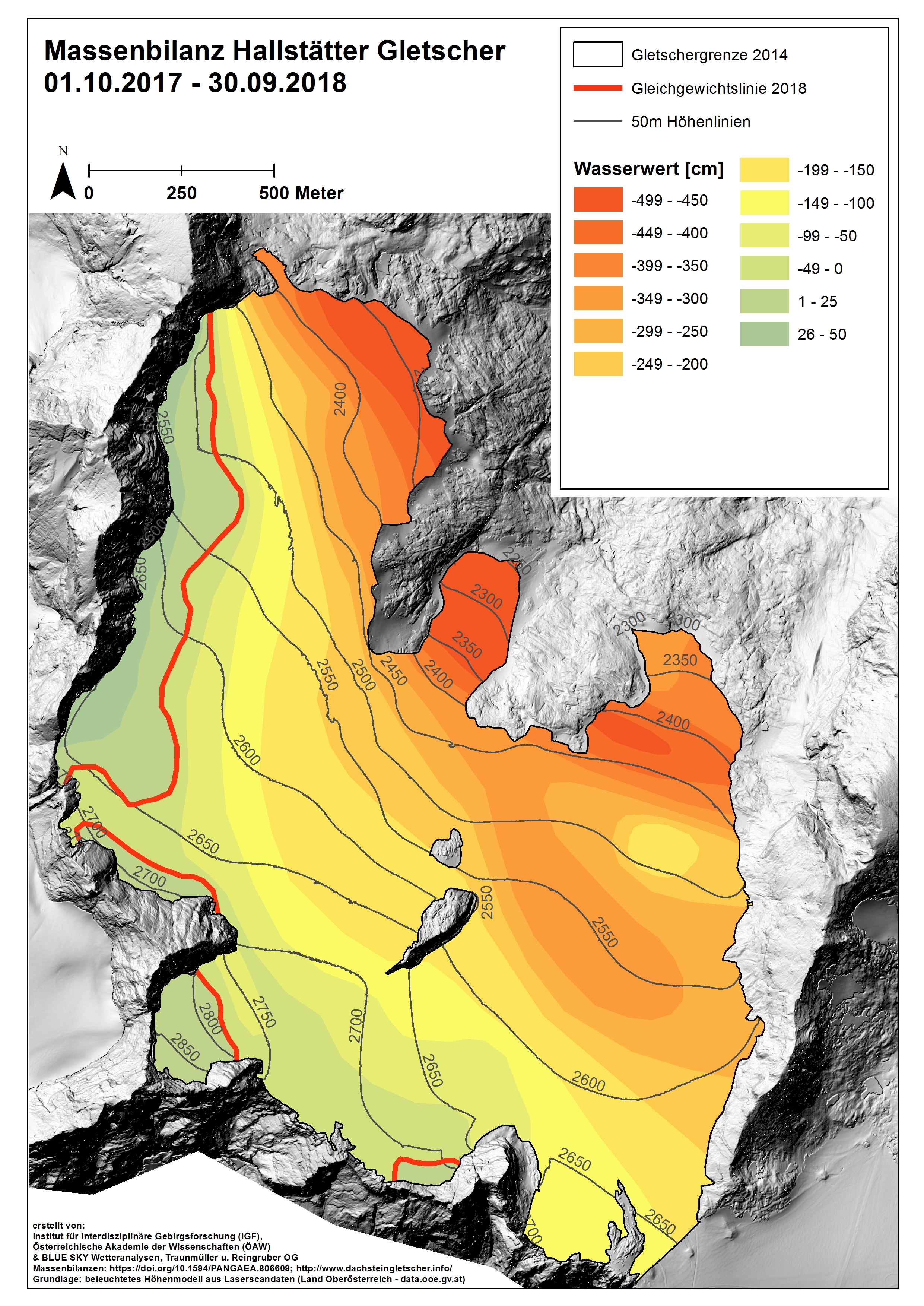

Abbildung 3. Ausaperungsmuster des Hallstätter Gletschers am 03.09.2009. Am Übergang zwischen Rücklage und Gletschereis sind als graue Schichten die Firnlagen der vergangenen Jahre zu erkennen. Bis zum Ende des hydrologischen Jahres am 30.09.2009 schritt die Ablation fort und weitere Flächen wurden schneefrei.
Abbildung 4. zeigt den Jahresverlauf des Niederschlages gemessen im Bereich des oberen Eissees unterhalb der mittleren Gletscherzunge. Der Jahresniederschlag im Haushaltsjahr 2006/2007 betrug 2615 mm (Vergleich 2007 (ZAMG): Salzburg 1174 mm, Innsbruck 840 mm) sowie 2259 mm im Haushaltsjahr 2007/2008 und 2710 mm 2008/2009. Die Niederschlagsmessung im hydrologischen Jahr 2009/2010 brachte einen Wert von Wert von 2290 mm hervor. Diese, mit rund 2500 mm erhöhten Niederschlagssummen sind ein wichtiger Grund dafür, das der Gletscher mit einer Medianhöhe von 2566 Metern in dem für alpine Gletscher niedrigen Höhenbereich zwischen 2190 m und 2900 m existiert. Die Massenbilanz des Hallstätter Gletschers fällt im Vergleich zu Gletschern in inneralpinen Regionen mit geringeren jährlichen Niederschlagssummen verhältnissmäßig gering negativ aus. So weist zum Beispiel der Hintereisferner (2007: -1798 mm w.e.; 2008: -1235 mm w.e.;2009: -1182 mm we.) im inneren Ötztal doppelt bis viermal soviel Eisverlust relativ zur Fläche auf.

Abbildung 3. Monatliche Aufteilung des Jahresniederschlages am Regenmesser unterhalb des Hallstätter Gletschers.
Die Messungen zeigen, dass die Massenbilanz des Hallstätter Gletschers sehr vom Niederschlag abhängig ist. Die Menge und Anzahl der im Sommer als Schnee fallenden Niederschläge bestimmt den Massenhaushalt vor Allem oberhalb der mittleren Höhe der Gleichgewichtslinie (ELA). Anhand des im September 2009 deutlich erkennbaren Ausaperungsmuster (Abb. 3) läßt sich ein starker Einfluß der Umverteilung des Schnees durch den Wind am Hallstätter Gletscher vermuten. Für eine Herstellung einer Beziehung zwischen dem Massenhaushalt des Hallstätter Gletschers und dem Klima sind noch weitere Messungen notwendig.
Eisdicke
Am 14.01.2009 wurden Messungen zur Erhebung der Eisdicke unter Verwendung eines Narod Radargerätes durchgeführt. Dabei wird von einer Sendeeinheit ein elektromagnetisches Signal mit einer Wellenlänge von 6,5 Mhz ausgesandt. Am 15 Meter entfernten Empänger wird zu einem das direkte Signal wie auch das Signal, welches an der Grenzfläche Eis – Fels an der Gletscherunterseite refektiert wird, aufgezeichnet. Aus dem Laufzeitunterschied dieser beiden Signale kann man auf die Entfernung des Reflexionspunktes schließen. Entscheidend für die Laufzeit des Signals sind die elektromagnetischen Eigenschaften des Gletschers. Inhomogenitäten wie Lufteinschlüsse, interne Schichten, Gletscherspalten, Wasser und eingeschlossenes Gestein beeinflussen die Qualität des Signals. Auch gilt zu beachten, das der Reflexionspunkt des Signales nicht genau unter der Radareinheut gelegen sein muß, sondern der nächstgelegene Punkt der Grenzfläche Eis/Fels ist. Bei einem rauhen Untergrund oder steilen Gletscherbereichen wird damit die Eisdicke eher unterschätzt.
In Abbildung 4. ist farblich abgestuft die über den Gletscher interpolierte Eisdicke dargestellt. Auf beiden Abbildungen ist ersichtlich, das der Hallstätter Gletscher in zwei Bereichen noch Eisdicken von weit über 100 Metern aufweist. Im Becken unterhalb der Steinerscharte ist das Eis noch bis zu 131 m dick. Auch im Bereich des östlichen Teils des Gletschers findet sich einen dolinenartige Vertiefung, welche noch mit 120 m Eis gefüllt ist. Deutlich zeigen sich jedoch dünnere Bereiche in Verlängerung des Eissteines zum bereits aperen Teil oberhalb des Eisjoches. Bei fortschreitendem Dickenverlust des Eises ist hier eine Trennung des östlichen Teils des Gletschers unterhalb des Dirndl vom westliche gespeisten Bereich denkbar.

Abbildung 4. Eisdicke des Hallstätter Gletschers 2007.
Mit Abzug der Eisdicke vom aktuellen Höhenmodell erhält man die Form des Untergrundes. Dieser ist in Abbildung 5. dargestellt. Auch hier zeigen sich die typischen becken- und dolinenartigen Strukturen des Karstgebirges.
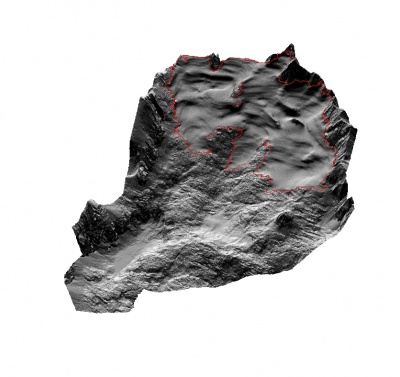
Abbildung 5. Profilbild des Untergrundes des Hallstätter Gletschers ermittelt aus Höhenmodell 2007 und Eisdickenmessung. Blick von Nord nach Süd.